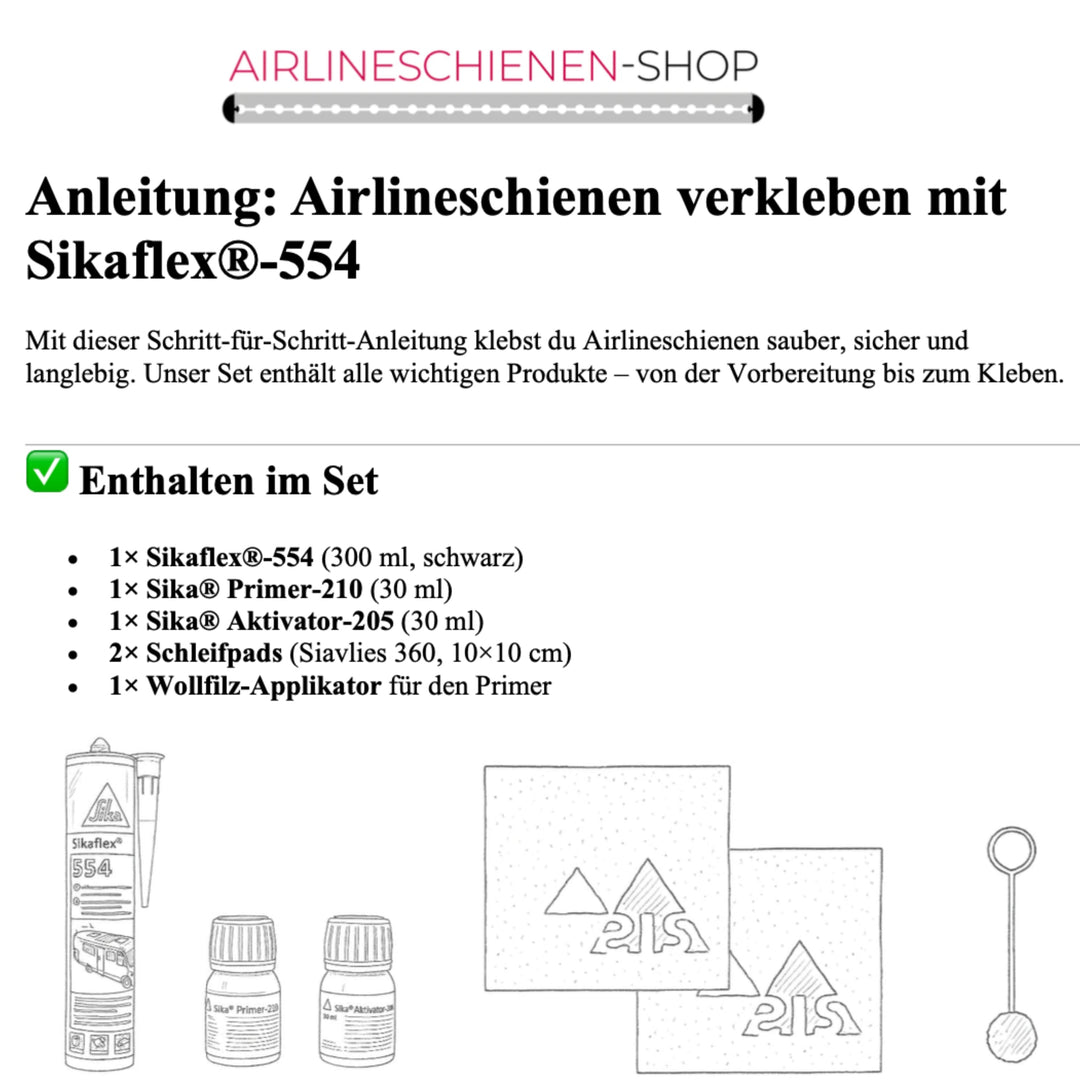Wie spannt man einen Spanngurt?
Der ultimative Ratgeber: Spanngurte richtig anwenden und Ladung sicher verzurren
Einleitung
Spanngurte gehören zu den wichtigsten Hilfsmitteln der Ladungssicherung. Richtig angewendet verhindern sie, dass Güter während der Fahrt verrutschen, kippen oder herabfallen. Das schützt Menschen, Fahrzeug und Ware und reduziert das Risiko von Bußgeldern und Ausfallzeiten. Dieser Leitfaden erklärt ohne Umwege, wie Spanngurte aufgebaut sind, wie du sie korrekt benutzt, welche Zurrmethoden sich wofür eignen, welche Zurrwinkel wirken, welche Vorschriften gelten und wie du Gurte pflegst, damit sie zuverlässig und langlebig bleiben.

Aufbau und Bestandteile eines Spanngurts
Gurtband: Das Band trägt die Last. Es besteht in der Regel aus Polyester oder Nylon, ist abriebfest und in unterschiedlichen Breiten und Längen erhältlich. Breitere Bänder verteilen Kräfte besser und sind weniger schnittanfällig an Kanten.
Ratsche: Der Spannmechanismus zieht das Band stufenweise fest. Eine Zahnsperre verhindert das selbsttätige Lösen. In der Trommel sammelt sich das eingezogene Band; daher ist handfestes Vorziehen wichtig, damit die Trommel nicht „überfüllt“.
Haken: Endbeschläge dienen der Verbindung zu den Zurrpunkten des Fahrzeugs oder einer Ladehilfe. Federnde Sicherungen verhindern unbeabsichtigtes Aushängen.
Schlaufe: Manche Gurte enden in einer vernähten Schlaufe. Damit legst du den Gurt um feste Punkte wie Pfosten, Ösen oder Schienen.
Klemmschloss vs. Ratsche: Klemmschlossgurte eignen sich für leichte Lasten und schnelles Handling. Ratschen-Spanngurte bauen deutlich höhere Vorspannkräfte auf und sind der Standard für mittlere bis schwere Ladungen.
Spanngurt richtig anwenden
Vorbereitung und Kontrolle: Prüfe vor jeder Nutzung Band, Nähte, Etikett und Beschläge. Risse, Schnitte, aufgefaserte Kanten, verformte Haken oder eine schwergängige Ratsche sind Ausschlusskriterien. Achte darauf, dass die auf dem Etikett angegebene Belastbarkeit zur Aufgabe passt. Plane geeignete Zurrpunkte ein und entschärfe scharfe Kanten an der Ladung mittels Kantenschutz, damit das Band nicht beschädigt wird.
Befestigung mit Ratsche – Einfädeln: Hänge die Haken an geeigneten Zurrpunkten ein. Führe das freie Bandende von der Rückseite in den Schlitz der geöffneten Ratsche und ziehe es durch die Trommel. Das Band muss glatt und verdrehungsfrei laufen; Knoten sind tabu.
Handstraff vorziehen: Ziehe das Band zunächst von Hand so straff wie möglich, bis es satt anliegt. Damit reduzierst du die benötigten Ratschenhübe und verhinderst, dass zu viel Band auf der Trommel liegt, was das Spannen blockieren kann.
Spannen: Bewege den Ratschenhebel ruhig auf und ab, bis die gewünschte Vorspannung erreicht ist. Die Ratsche fixiert die Stellung automatisch. Lässt sich der Hebel nicht sinnvoll weiterbewegen, ist in der Regel genügend Spannung vorhanden.
Sichern des Überstands: Lose Bandenden dürfen nicht im Fahrtwind schlagen. Rolle das Übermaß sauber auf und sichere es, z. B. mit Gummiring, Klettband oder einer Binde.
Anwendung mit Klemmschloss: Führe das Band durch die Klemmöffnung, ziehe per Hand straff und lass die Federklemme das Band halten. Zum Lösen genügt das Niederdrücken der Federlasche. Diese Variante ist schnell, eignet sich aber nur für geringere Belastungen.
Spanngurt sicher lösen
Entlaste den Gurt, wo möglich, bevor du löst. Ziehe dann den Sicherungshebel der Ratsche in Richtung Griff, um die Zahnsperre zu entriegeln, und klappe die Ratsche vollständig auf. Das Band sollte nun frei ablaufen. Hakt der Mechanismus, bewege den Griff unter leichtem Zug am Band stückweise, bis das Band rückwärts aus der Trommel läuft. Vermeide es, Hände in den möglichen Bandrücklauf zu halten.
Pflege, Lagerung und Lebensdauer
Reinigung: Entferne nach dem Einsatz Schmutz, Sand und Fremdkörper aus Band und Ratsche. Schmutz erhöht den Verschleiß und kann die Mechanik blockieren.
Trocknung: Nasse Gurte immer hängend trocknen. Feucht aufgerollte Bänder fördern Schimmel, verringern die Festigkeit und beschädigen Nähte.
Aufrollen und Aufbewahren: Rolle Gurte glatt und spannungsfrei auf. Bewahre sie trocken, dunkel und vor UV-Strahlung geschützt auf. Aufrollhilfen erleichtern das schnelle, saubere Verstauen.
Inspektion und Austausch: Prüfe regelmäßig auf Schnitte, Ausfransungen, verbrannte Kanten, gequetschte Beschläge und verbogene Haken. Defekte Gurte sofort aussondern und ersetzen.
Methoden der Ladungssicherung

Niederzurren (kraftschlüssig): Der Gurt verläuft über die Ladung und presst sie auf die Ladefläche. Dadurch steigt die Reibungskraft zwischen Ladung und Untergrund. Für diese Methode sind die Vorspannkraft (STF) und die Handkraft (SHF) zentrale Größen. Ein möglichst steiler Zurrwinkel zur Ladefläche erhöht die wirksame Vorspannung. Setze mindestens zwei Gurte ein und spanne möglichst gegeneinander, um symmetrische Kräfte zu erzielen.

Direktzurren (formschlüssig): Die Ladung wird nicht niedergepresst, sondern direkt in Position gehalten. Die Lashing Capacity (LC) des Gurts ist hier maßgeblich. Typische Varianten sind Schrägzurren, Diagonalzurren, Schlingenzurren, Buchtlashing (Umreifung) und Kopflashing. Die richtige Wahl hängt von Form, Gewicht, Schwerpunkt und Zurrpunkten der Ladung ab.
Schrägzurren: Gurte laufen schräg von den Zurrpunkten zur Ladung und sichern zu allen vier Seiten. Diese Methode eignet sich für kompakte Güter mit definierten Anschlagpunkten.
Diagonalzurren: Je ein Gurt sichert eine Ecke des Ladeguts; mindestens vier Gurte sind erforderlich. Achte auf ausreichende Winkel, damit bei Bremsen und Kurvenfahrt genügend Haltekraft in alle Richtungen wirkt.
Schlingenzurren: Das Band umschlingt die Ladung seitlich, vorne oder hinten wie eine Schlaufe und wird an Zurrpunkten fixiert. Nützlich, wenn keine formschlüssigen Anschlagpunkte am Gut vorhanden sind.
Buchtlashing (Umreifung): Die Ladung wird mit mindestens zwei Gurten umspannt, die Enden jeweils an Zurrpunkten befestigt. So entsteht ein Bordwand-Ersatz, der besonders seitliches Verrutschen verhindert. Werden die beiden Enden an separaten Punkten befestigt, wirkt die Sicherungskraft in beide Richtungen.
Kopflashing: Ein senkrecht oder leicht geneigt geführter Gurt ersetzt die Kopfwand bzw. Rückwand des Fahrzeugs und verhindert ein Verrutschen in Fahrtrichtung oder nach hinten. Häufig wird eine Palette oder ein Halteband als Anlagefläche genutzt, damit der Gurt nicht wandert.
Kombination der Methoden: In der Praxis ist eine Kombination aus Direktzurren und Niederzurren oft optimal: Umreifung oder Kopflashing sichert gegen Längs- und Seitenschub, ein zusätzlicher Niederzurrgurt erhöht die Reibung nach unten. Antirutschmatten und Kantenschoner verbessern die Wirkung und schonen das Material.

Zurrwinkel und ihre Wirkung
Beim Niederzurren: Ziel ist ein Winkel nahe 90° zwischen Gurt und Ladefläche. Zwischen 83° und 90° bleibt die Vorspannkraft nahezu optimal. Sinkt der Winkel deutlich, wirkt weniger Kraft nach unten; unter 35° sollte Niederzurren vermieden werden, weil die Haltewirkung stark abnimmt.
Beim Direktzurren: Entscheidend sind der Vertikalwinkel α (zwischen Gurt und Ladefläche) und der Horizontalwinkel β (zwischen Gurt und Fahrzeuglängsrichtung). α sollte idealerweise zwischen 20° und 65° liegen, β zwischen 6° und 55°. Zu steile oder zu flache Winkel reduzieren die resultierende Sicherungskraft in der erforderlichen Richtung.
Kraftschlüssig vs. formschlüssig – die Unterschiede

Kraftschlüssige Sicherung: Die Haltekraft entsteht über erhöhte Reibung zwischen Ladung und Ladefläche. Setze sie ein, wenn die Auflageflächen griffig sind, die Last kompakt ist und sich sicher niederpressen lässt. Antirutschmatten steigern die Reibungszahl und damit die Wirksamkeit dieser Methode deutlich.

Formschlüssige Sicherung: Die Haltekraft entsteht durch direkte Abstützung beziehungsweise Verspannung der Ladung gegen feste Punkte. Diese Methode eignet sich für unregelmäßig geformte Güter, hohe Schwerpunkte oder empfindliche Flächen, die du nicht niederpressen möchtest. Hilfsmittel wie Sperrstangen, Sperrbalken und Netze unterstützen den Formschluss.
Praxis: Größere oder schwerere Transporte profitieren von einer durchdachten Kombination beider Prinzipien: formschlüssig gegen Bewegungen in Längs- und Querrichtung, kraftschlüssig nach unten. So sicherst du effektiv in alle Freiheitsgrade.
Relevante Kennwerte und Etikettangaben
Lashing Capacity (LC): Die zulässige Zugkraft im geraden Zug. Beim Direktzurren ist LC der maßgebliche Kennwert. Beispiel: LC 2.500 daN bedeutet, dass der Gurt im geraden Zug bis ca. 2.500 kg (näherungsweise) belastet werden darf.
Vorspannkraft (STF): Die erreichbare Sicherungskraft durch das Vorspannen beim Niederzurren. Sie wirkt senkrecht zur Ladefläche und erhöht die Reibung. Die angegebene STF gilt idealerweise bei 90° Zurrwinkel.
Handkraft (SHF): Die standardisierte Kraft, die zum Spannen aufgebracht werden darf. Sie begrenzt, wie stark du den Ratschenhebel belasten sollst, um Material und Mechanik nicht zu überbeanspruchen.
Dehnung: Die Banddehnung unter Last beeinflusst, wie konstant die Vorspannung bleibt. Geringe Dehnung ist vorteilhaft für stabile Sicherung; zu hohe Dehnung führt zum „Nachgeben“ im Betrieb.
Material- und Pflegehinweise: Das Etikett informiert über Material, Normkonformität, Hersteller, Produktionsjahr und Pflege. Fehlende oder unleserliche Etiketten sind ein Austauschgrund, insbesondere im gewerblichen Verkehr.
Rechtliche Grundlagen und Normen
StVO (Deutschland): Ladung muss so gesichert sein, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlichen Ausweichmanövern weder verrutscht noch herabfällt oder Lärm verursacht. Verantwortlich sind Fahrzeugführer und Verlader.
Fahrzeugbetriebsverordnung (FbV): Regelt u. a. Mindestanforderungen an Ausrüstung und Zustand. Für Gurte sind Bruchlast, Dehnung und regelmäßige Kontrollen maßgeblich.
BGV/GUV-V C1: Berufsgenossenschaftliche Vorschriften zur sicheren Verwendung von Lastaufnahmemitteln, zu Auswahl, Einsatz und Prüfung im Arbeitsumfeld.
EN 12195-2:2010: Europäische Norm für Zurrgurte aus Chemiefaser. Sie definiert Anforderungen, Prüfverfahren und Kennzeichnungen und legt fest, wie Kennwerte wie LC, STF und SHF zu verstehen sind. Die Norm beschreibt außerdem, wie viele Gurte und welche Belastbarkeiten je nach Ladung und Methode erforderlich sind.
Praxisleitfaden: so gehst du strukturiert vor
1. Ladung analysieren: Gewicht, Schwerpunkt, Geometrie, Oberfläche, Empfindlichkeit. Prüfe, wo formschlüssige Anschlagpunkte vorhanden sind und wo Kanten entschärft werden müssen.
2. Methode wählen: Niederzurren, Direktzurren oder Kombination. Für kompakte, robuste Güter mit guter Auflage eignet sich Niederzurren; für sperrige oder empfindliche Ladung Direktzurren bzw. Umreifung und Kopflashing.
3. Zurrpunkte festlegen: Nur tragfähige, geprüfte Zurrpunkte am Fahrzeug nutzen. Achte auf ausreichende Anzahl und sinnvolle Winkel. Vermeide zu flache Verläufe.
4. Hilfsmittel einsetzen: Antirutschmatten erhöhen die Reibung; Kantenschoner schützen Band und Ware; Sperrstangen und -balken stellen Formschluss her; Schutzdecken verhindern Abrieb.
5. Gurte vorbereiten und spannen: Verdrehungsfrei anlegen, Band handstraff vorziehen, Ratsche sauber bedienen, Überstände sichern.
6. Kontrolle vor Abfahrt: Sitz der Gurte, Winkel, Kantenauflagen, Hakenpositionen und Ratschenstellung prüfen. Bei Bedarf nachspannen.
7. Kontrolle unterwegs: Nach wenigen Kilometern kurz prüfen, ob sich etwas gesetzt hat, und ggf. nachspannen. Bei Witterungswechseln (Regen, Kälte) zusätzliche Kontrollen einplanen.
Häufige Fehler – und wie du sie vermeidest
Verdrehte oder geknotete Bänder: Drehungen und Knoten reduzieren die Tragfähigkeit und fördern Abrieb. Immer glatt und geradlinig verlegen.
Zu flache Winkel: Beim Niederzurren gehen Kräfte „ins Leere“, wenn der Winkel zu klein ist. Strebe 90° an; unter 35° meiden. Beim Direktzurren α zwischen 20–65° und β zwischen 6–55° einhalten.
Überlastung durch falsche Wahl: Klemmschloss statt Ratsche, zu schmale Bänder oder zu wenige Gurte führen zu unzureichender Sicherung. LC, STF und SHF beachtet wählen.
Ohne Kantenschutz: Scharfe Kanten schneiden Bänder an. Immer Kantenschoner einsetzen oder die Kante entschärfen.
Schmutz und Korrosion: Dreck in der Ratsche blockiert Zahnräder und Federn; feuchte Lagerung schwächt Fasern. Sauber halten und trocken lagern.
Keine Nachkontrolle: Setzerscheinungen und Vibrationen lösen Vorspannung. Kurz nach Fahrtbeginn und bei langen Touren erneut prüfen.
Beispiele aus der Praxis
Kompakte Maschinen auf Palette: Formschluss durch dichtes Verladen und Umreifung (Buchtlashing) zu beiden Seiten. Zusätzlich ein Niederzurrgurt über die Oberseite, um Reibung zu erhöhen. Kantenschutz an Kanten, Antirutschmatten unter der Palette.
Motorrad auf Anhänger: Direktzurren mit vier Gurten in geeigneten Winkeln, je ein Gurt pro Ecke (Diagonalzurren). Lenker und Heck mit geeigneten Schlaufen anschlagen, Federung leicht einfedern, damit sich die Vorspannung nicht verliert. Keine Gurte über scharfe Kanten der Verkleidung führen.
Kartonware auf Planenfahrzeug: Niederzurren mit mehreren Gurten über die Ladung, Zurrwinkel steil halten. Antirutschmatten unterlegen, Kopflashing zusätzlich, wenn keine Kopfwandauflage möglich ist. Überstände der Gurte sauber fixieren, um Flattern zu verhindern.
Check vor dem Einsatz
Ist der Gurt intakt? Keine Risse, Schnitte, Brandspuren, beschädigten Nähte.
Passt die Kennzeichnung? LC/STF/SHF ausreichend, Etikett lesbar, Normangaben vorhanden.
Sind Zurrpunkte geeignet? Tragfähig, beschädigungsfrei, in ausreichender Anzahl vorhanden.
Sind Winkel sinnvoll? Beim Niederzurren möglichst nahe 90°, beim Direktzurren α und β im empfohlenen Bereich.
Sind Hilfsmittel verwendet? Antirutschmatten, Kantenschutz, Sperrbalken, Schutzdecken nach Bedarf.
Sind Überstände gesichert? Keine flatternden Bandenden; alles sauber fixiert.
Fazit
Effektive Ladungssicherung beginnt mit der richtigen Methode und endet mit der sauberen Ausführung. Vertraue bei kompakten, robusten Gütern auf Niederzurren mit steilen Winkeln und ausreichender Vorspannkraft. Nutze beim Direktzurren die LC des Gurts und halte die empfohlenen Winkelbereiche ein, insbesondere bei sperrigen oder empfindlichen Ladungen. Kombiniere beide Prinzipien, wo es sinnvoll ist, und setze Hilfsmittel gezielt ein. Pflege und prüfe deine Gurte konsequent – defekte Ausrüstung gehört aus dem Verkehr. Wer diese Grundsätze beherzigt, schützt Menschen und Material, erfüllt die rechtlichen Vorgaben und arbeitet effizient.